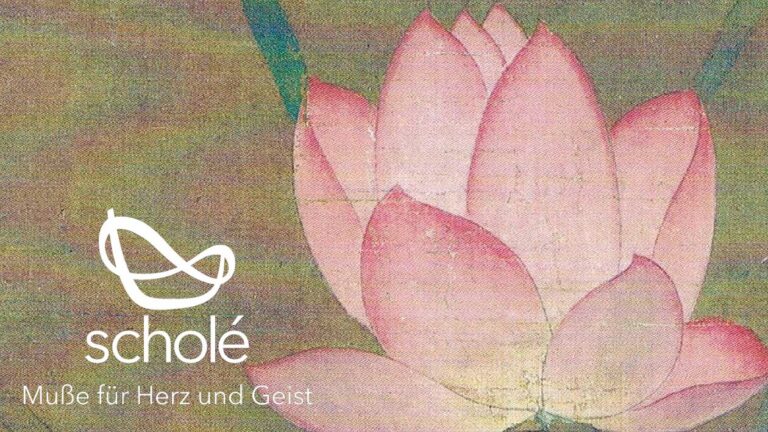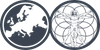SLAPP: Strategische Klagen als "Ohrfeigen" ...
SLAPP-Anklagen (englisch: Strategic Lawsuits Against Public Participation, deutsch: Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung) sind missbräuchliche Gerichtsverfahren, die vor allem dazu dienen, kritische Stimmen einzuschüchtern, zu belasten oder gar mundtot zu machen. Ziel solcher Klagen ist es nicht, einen berechtigten Rechtsanspruch durchzusetzen, vielmehr die öffentliche Kritik an Unternehmen oder Akteuren zu unterbinden. Könnte diese Strategie auch zur Anwendung kommen, wenn bahnbrechende Technologien verbreitet werden wollen?
Das Vorgehen stellt einen Missbrauch der Ressourcen des Rechtssystems dar. Häufig werden Rechtsverstöße lediglich vorgeschoben, ohne dass eine realistische Aussicht besteht, den behaupteten Verstoß tatsächlich nachzuweisen. Es ist gängige Praxis, Menschen unbegründet der Verleumdung oder Rufschädigung zu bezichtigen. Auch Vorwürfe wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Betrug werden immer wieder erhoben und führen bei den Betroffenen rasch zu Verunsicherung. Besonders problematisch ist, dass solche Anschuldigungen für die Öffentlichkeit im Detail kaum überprüfbar sind. Statt der Unschuldsvermutung dominiert häufig eine Vorverurteilung, wodurch Betroffene oft schon vor oder sogar nach Abschluss eines Gerichtsverfahrens nachhaltig diskreditiert bleiben.
SLAPPs dienen ursprünglich dazu, Betroffene einzuschüchtern und zu belasten. Gesellschaftlich betrachtet beeinträchtigen sie nicht selten die Meinungs- und Pressefreiheit und gefährden demokratische Debatten, da kritische Berichterstattung und zivilgesellschaftliches Engagement gezielt unterdrückt werden.
Auch aus technischer oder technologischer Sicht wirken sich SLAPPs negativ aus: Sie bremsen oder verhindern innovative Entwicklungen, weil Betroffene durch die Anschuldigungen in Misskredit geraten und es ihnen nicht mehr gelingt, die von der Öffentlichkeit erwarteten Meilensteine rechtzeitig zu erreichen. Oft genügt bereits der bloße Vorwurf, um Betroffene in ihrem Handeln und ihren Aktivitäten massiv einzuschränken. Gerade bei Betrugsvorwürfen kann schon die Anschuldigung allein dazu führen, dass verschiedene Institutionen interaktiv reagieren, was nicht selten zu einem eingeschränkten Zugang zu finanziellen Ressourcen während und auch nach der SLAPP Attacke führt.
Folgen für Betroffene
Eine SLAPP-Klage hat für die Betroffenen meist schwerwiegende persönliche, finanzielle und gesellschaftliche Folgen. Bereits die Konfrontation mit einer solchen Klage löst bei vielen Betroffenen große Verunsicherung, Angst und Stress aus, da sie sich plötzlich mit schwerwiegenden Vorwürfen – etwa Verleumdung, Betrug oder anderen Delikten – auseinandersetzen müssen. Selbst wenn die Anschuldigungen haltlos sind, kann schon die öffentliche Erhebung der Vorwürfe den Ruf der Betroffenen nachhaltig schädigen. Oft reagieren auch das soziale Umfeld und Geschäftspartner mit Zurückhaltung, was zur sozialen Isolation führen kann.
Hinzu kommen erhebliche finanzielle Belastungen, da die Verteidigung gegen eine SLAPP-Klage mit hohen Anwalts- und Gerichtskosten verbunden ist. In vielen Fällen erschweren die Vorwürfe zudem den Zugang zu finanziellen Ressourcen, weil Banken, Investoren oder andere Institutionen auf Distanz gehen. Die ständige Bedrohung durch weitere rechtliche Schritte führt häufig dazu, dass Betroffene sich selbst zensieren und auf öffentliche Stellungnahmen oder kritische Berichterstattung verzichten. Besonders gravierend ist dies, wenn wichtige gesellschaftliche oder technische Projekte ins Stocken geraten, weil die Betroffenen durch die Klage abgelenkt oder diskreditiert werden.
Beispiele für bekannte SLAPP's
- Klagen gegen Journalisten, die über Umweltverschmutzung oder Korruption berichten.
- Klagen gegen Gesundheits- oder Rechtsvertreter, die vorgegebene gesellschaftliche Rituale infrage stellen.
- Verfahren gegen NGOs, die Unternehmen wegen schädlicher Geschäftspraktiken kritisieren.
- Abmahnungen (und Klagen) gegen Aktivisten, die Petitionen, Flugblätter oder Protestaktionen organisieren
SLAPPs werden als ernsthafte Gefahr für Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit betrachtet, weshalb sich in Europa und anderswo zivilgesellschaftliche Bündnisse und Initiativen gegen diese Praxis engagieren.