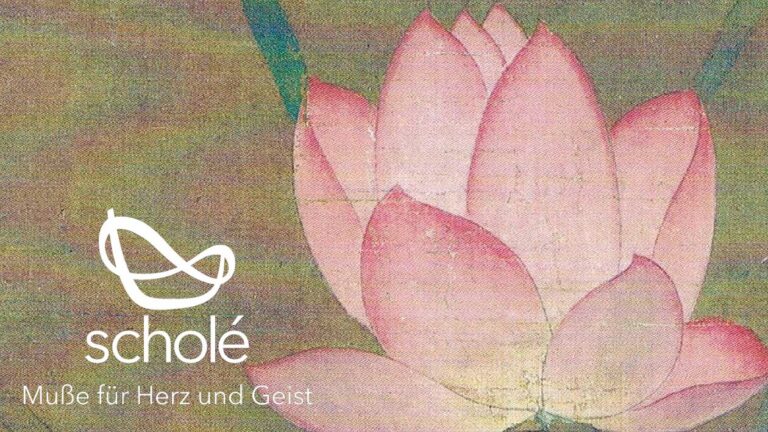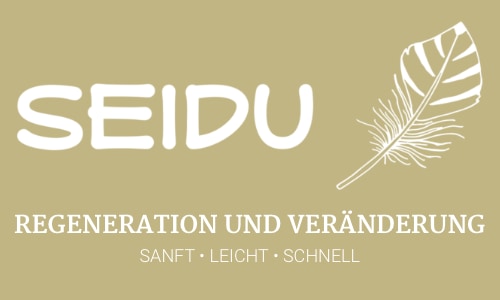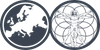Veränderungen der Energie der Sonne in den letzten 45 Jahren
Die Sonne wirkt auf verschiedene Weise auf das Klima ein. Zum einen durch ihre direkte Strahlung, die auf die Erde trifft. Diese verändert sich, da die Sonne verschiedene Aktivitätszyklen durchläuft, die unter anderem an der Zahl der Sonnenflecken erkennbar sind. Zum anderen verändert sich der Abstand zwischen Sonne und Erde kontinuierlich: Einerseits umkreist die Sonne den Massenschwerpunkt des Sonnensystems auf einer epitrochoiden Bahn mit einem Zyklus von etwa 175 Jahren, andererseits verändert sich auch die Erdbahn im Rahmen der sogenannten Milanković-Zyklen.
Hinzu kommen indirekte Effekte: Nimmt die Sonnenaktivität ab, schwächt sich auch ihr Magnetfeld. Infolgedessen wird die kosmische Strahlung weniger stark abgelenkt und erreicht vermehrt die Erde. Die darin enthaltenen Teilchen und Atomkerne wirken in den oberen Schichten der Atmosphäre als Kristallisationskerne für Wolkenbildung. Je mehr Wolken entstehen, desto mehr Sonnenlicht wird ins All zurückreflektiert – und desto stärker kühlt sich die Erde ab.
Zudem ist eine verringerte Sonnenaktivität häufig mit einer erhöhten vulkanischen Aktivität verbunden. Der dabei freigesetzte Schwefel sowie Aerosole tragen ebenfalls zur Abkühlung des Klimas bei.
Seit Jahrhunderten ist bekannt, dass die Sonne im Laufe der Zeit subtile und weniger subtile Veränderungen durchläuft. Als Galileo Galilei beispielsweise sein Teleskop auf die Sonne richtete, entdeckte er, dass die Sonne nicht perfekt ist und oft von dunklen Flecken, den sogenannten Sonnenflecken, übersät ist. Heute wissen wir, dass Sonnenflecken sehr große Gebilde sind – oft um ein Vielfaches größer als die Erde. Doch erst 1978, als die ersten Satellitenmissionen zur kontinuierlichen Beobachtung der Sonne gestartet wurden, wurde es möglich, die Veränderungen der Sonnenenergie direkt zu messen, ohne dass die Erdatmosphäre störte.
Instrumente zur Beobachtung der Sonne auf Satelliten beschreiben die von der Sonne zur Erde gelangende Energie als totale solare Strahlungsintensität (TSI). Diese Satellitenmessungen zeigen, dass die durchschnittliche TSI, die die Erde erreicht, bei etwa 1360–1365 Watt pro Quadratmeter (W/m2) liegt. Sie zeigen auch, dass die TSI im Laufe eines Sonnenfleckenzyklus (etwa 8–13 Jahre) leicht ansteigt und wieder abfällt. Die meisten Missionen mit Satelliten dauern jedoch nur etwa 1 bis 2 Sonnenfleckenzyklen. Um die Veränderungen der TSI über einen Zeitraum von mehr als 10 bis 15 Jahren zu untersuchen, müssen Wissenschaftler daher die TSI-Messungen mehrerer Missionen von Satelliten zusammenfügen oder „zusammennähen”.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es eine wissenschaftliche Kontroverse zwischen rivalisierenden Teams von Wissenschaftlern darüber, wie die TSI-Missionen am besten zu einer kontinuierlichen Aufzeichnung für die gesamte Satellitenära, d. h. von 1978 bis heute, zusammengefügt werden können.
Dem Thema widmet sich die Studie von Ronan Connolly et al mit dem Titel „Multiple New or Updated Satellite Total Solar Irradiance (TSI) Composites (1978–2023)“ (Mehrere neue oder aktualisierte Satelliten-Komposite der gesamten solaren Strahlungsintensität (TSI) (1978–2023)).
Sie setzt sich zunächst mit den Methoden und Ergebnissen verschiedener Forscher auseinander. So hat das Team des Active Cavity Radiometer Irradiance Monitoring (ACRIM), das für das ACRIM-Satellitenprojekt der NASA verantwortlich ist, sich beispielsweise dafür entschieden, die Daten der wissenschaftlichen Teams der Satellitenmissionen zu verwenden. Im Gegensatz dazu nahm das Team des Physikalisch-Meteorologischen Observatoriums in Davos (PMOD) verschiedene Datenanpassungen an jeder der Satellitenmissionen vor, bevor es seine Zusammensetzung erstellte.
Die ACRIM – Zusammensetzung deutete darauf hin, dass es neben den Veränderungen der TSI im Laufe eines Sonnenfleckenzyklus auch langfristige Veränderungen der TSI zwischen den Sonnenfleckenzyklen gibt. Sie deutete auf die Möglichkeit hin, dass diese langfristigen Veränderungen der TSI zur globalen Erwärmung beitragen könnten.
Die PMOD-Zusammensetzung deutete jedoch darauf hin, dass sich die TSI zwischen den Sonnenfleckenzyklen nicht wesentlich verändert. Sie schloss die Möglichkeit aus, dass TSI-Veränderungen ein wesentlicher Faktor für die globale Erwärmung sind.
Die jüngsten Berichte des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel (IPCC) der Vereinten Nationen bevorzugten ausdrücklich Zusammensetzungen wie die von PMOD gegenüber denen von ACRIM.
Diese neue, von Fachkollegen begutachtete Arbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift „The Astrophysical Journal” veröffentlicht, die 1895 gegründet wurde und nach wie vor zu den führenden Fachzeitschriften für Astronomie und Astrophysik zählt. Das ist knallharte Physik.